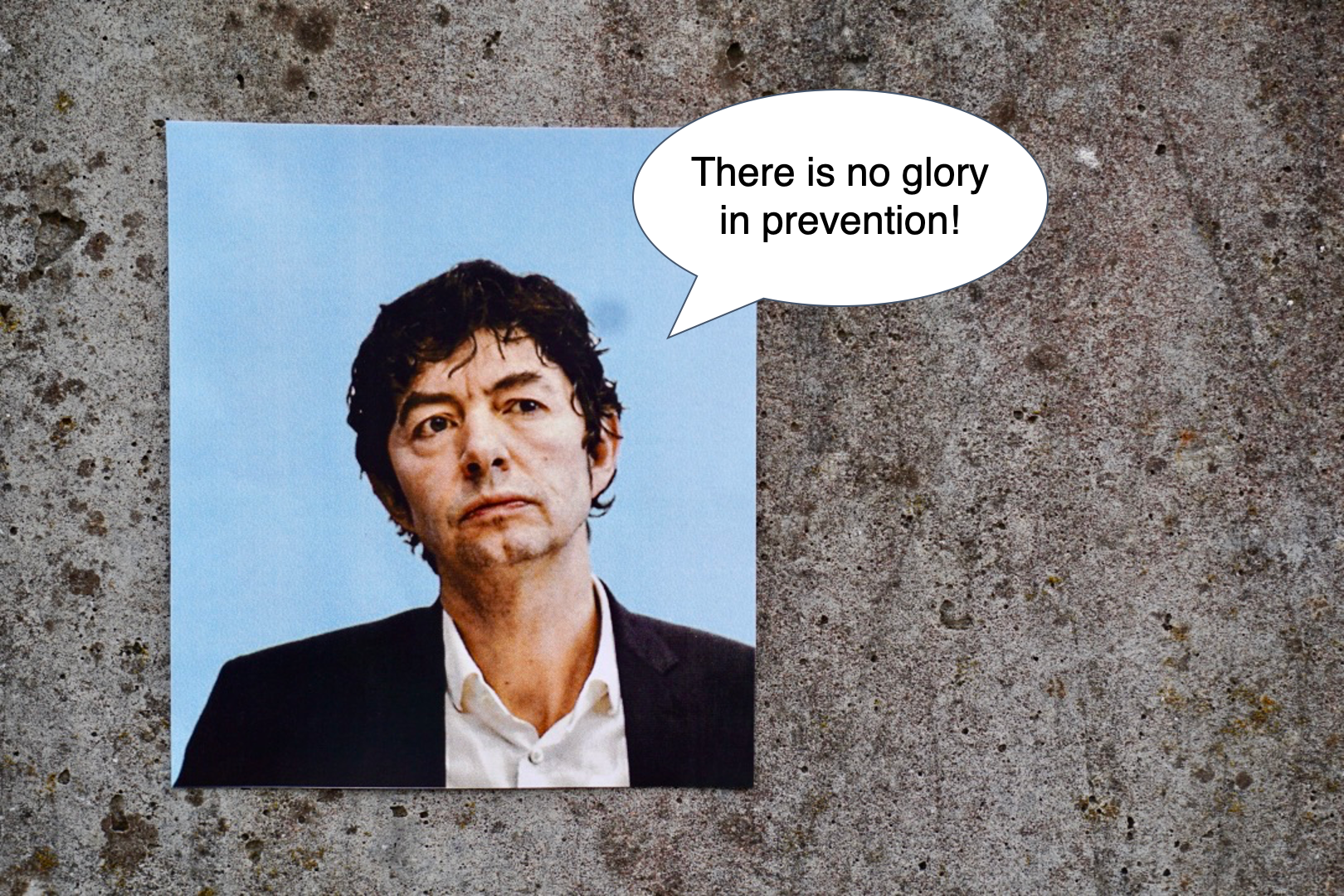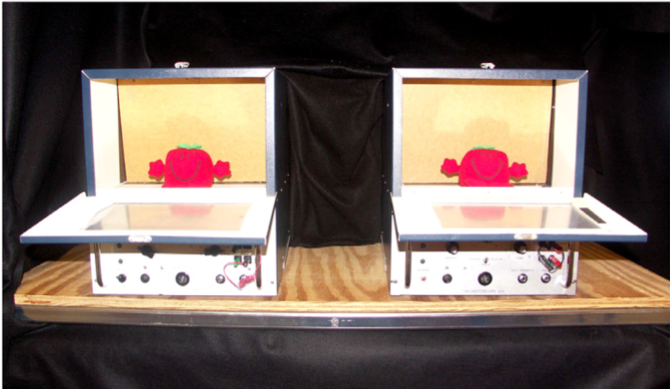Ein T-Shirt für 19,99 EUR, Flüssigseife für 1,99 EUR und der neueste Thriller von Sebastian Fitzek für 22,99 EUR. Eigentlich könnte man doch gleich 20 EUR für das Shirt, 2 EUR für die Seife und 23 EUR für das Buch verlangen, oder? Macht es doch kaum einen finanziellen Unterschied und würde z.B. unnötiges 1 Cent-Rückgeld geben vermeiden. Ok, das Argument zählt mittlerweile – wo beinahe jeder mit Karte bezahlt – kaum noch, aber tatsächlich wirkt diese Preisgestaltung schon ein wenig kompliziert.

Produkte mit 99er-Preis werden mehr gekauft
Wirken die 99er-Preise tatsächlich günstiger und fallen wir als Verbraucher:innen darauf rein? In einer recht bekannten Studie wollten die amerikanischen Forschenden Robert Schindler und Thomas Kibarian (1996) genau diese Frage beantworten. Dafür versendeten sie in Summe 90.000 Warenkataloge. Ein Drittel dieser Kataloge enthielt die typischen 99er Preise, also 4,99, 9,99 oder 19,99, das zweite Drittel der Kataloge bewarb Produkte mit glatten Preisen, also zum Beispiel 5, 10 oder 20 und das letzte Drittel der Prospekte beinhaltete Produkte mit 88er-Preise, also beispielsweise 4,88, 9,88 oder 19,88.
Das bedeutet, dass die Preise des letzten Drittels im Durchschnitt am niedrigsten waren und daher zu erwarten gewesen wäre, dass – wenn der Mensch ökonomisch handeln würde – am meisten Produkte aus diesen Katalogen gekauft wurden. Die Realität sah allerdings anders aus! Am meisten wurden Produkte aus den 99-er Katalogen gekauft und zwar signifikant mehr als aus beiden anderen Katalog-Versionen. In Prozent ausgedrückt kauften die Konsumierenden 8% mehr, wenn die Produkte auf «,99» endeten.
Warum tappen wir in die 99er-Falle?
Die Forschenden wollten nun natürlich verstehen: Was ist der Grund dafür? Fühlt sich 1 Cent weniger tatsächlich nach deutlich günstiger an? Um das zu untersuchen, wurden Proband:innen in einem Experiment (Bizer & Schnindler, 2005) daher entweder gefragt: «Wie viele Produkte zum Preis von 2,99 Dollar kann man mit 73 Dollar kaufen?» oder ihnen wurde die Frage «Wie viele Produkte zum Preis von 3 Dollar kann man mit 73 Dollar kaufen?». Tatsächlich stellte sich heraus, dass die Versuchsteilnehmenden kleinere Fehler bei der Aufaddierung machten und die Anzahl der Produkte mit 99er Preisen, die man für 73 Dollar kaufen kann, leicht überschätzten. Dieser Effekt wird verstärkt, wenn die Motivation, die Preise genau anzusehen, nicht sonderlich hoch ist oder der Konsumierende müde oder erschöpft ist.
Darüber hinaus gibt es noch einen wichtigen Bedeutungseffekt. Damit wird beschrieben, dass die 99er-Preise eine Botschaft senden. Diese Preise wirken auf Probanden als sei es der niedrigste verfügbare Preis, als wäre er seit einiger Zeit nicht mehr angehoben worden beziehungsweise, dass es sich um ein Sonderangebot handelt (Schindler & Kibarian, 2001). Sonderangebote sind sowieso ein spannendes Thema: Dort ist nämlich tatsächlich die Höhe des Rabattes entscheidender für die Kaufentscheidung als der finale Endpreis (Boz, Arslan & Koc, 2017).

Luxusmarken setzen auf glatte Preise
Luxusmarken machen sich den oben erklärten Bedeutungseffekt übrigens zu Nutze, indem sie genau das Gegenteil tun. Dort findet man selten sogenannte «gebrochene Preise», sondern meistens glatte Preise, da diese Qualität und Luxus ausdrücken sollen. So konnte zum Beispiel experimentell nachgewiesen werden, dass sich eine Flasche Champagner besser verkaufte, wenn sie 40 Dollar anstatt 39,72 oder 40,28 Dollar kostete (Wadhwa & Zhang 2015).
Unglaublich, dass wir Konsument:innen uns wirklich davon beeinflussen lassen, nicht wahr? Die gute Nachricht ist allerdings, genau wie bei anderen Effekten, dass sie – zumindest zum Teil – ihre Wirksamkeit verlieren, wenn wir uns ihrer bewusst sind. In diesem Sinne: Happy Shopping.
Literatur
Bizer, G. Y., & Schindler, R. M. (2005). Direct evidence of ending‐digit drop‐off in price information processing. Psychology & Marketing, 22(10), 771-783.
Boz, H., Arslan, A., & Koc, E. (2017). Neuromarketing aspect of tourısm pricing psychology. Tourism Management Perspectives, 23, 119-128.
Schindler, R. M., & Kibarian, T. M. (1996). Increased consumer sales response though use of 99-ending prices. Journal of Retailing, 72(2), 187-199.
Schindler, R. M., & Kibarian, T. M. (2001). Image communicated by the use of 99 endings in advertised prices. Journal of Advertising, 30(4), 95-99.
Wadhwa, M., & Zhang, K. (2015). This number just feels right: The impact of roundedness of price numbers on product evaluations. Journal of Consumer Research, 41(5), 1172-1185.