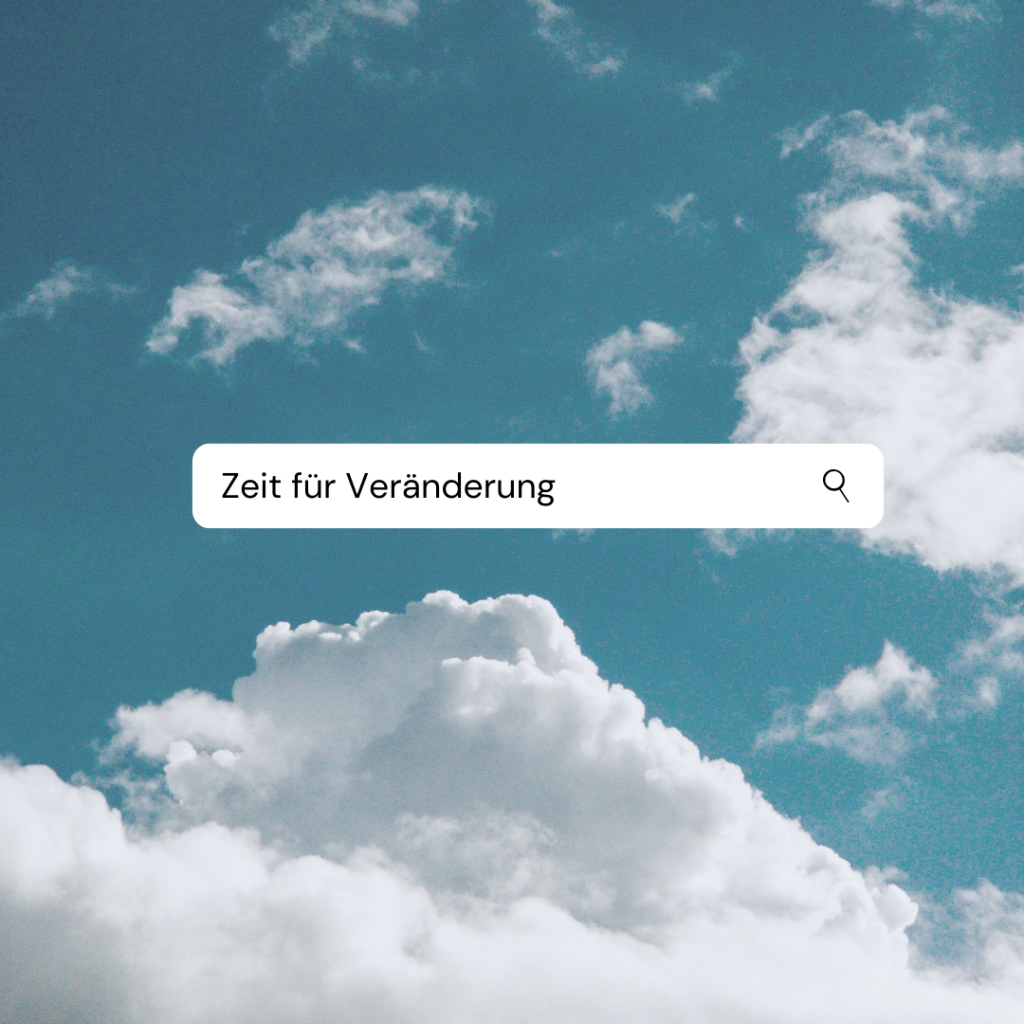Schlafen ist was Wunderbares. Morgen ausgeschlafen ohne Wecker aufzuwachen ist grossartig und doch kommt es im Alltag höchst selten vor. Wir nehmen uns vor früh ins Bett zu gehen und schaffen es doch irgendwie durch Rumgruschen, Serie gucken oder Handy-Daddeln unsere Zubettgehe-Zeit hinauszuzögern. Warum tun wir das, wo wir doch genau wissen, wie sehr uns der Schlaf am nächsten Tag fehlen wird.
Psycholog:innen nennen dieses Phänomen Bedtime Procrastination, also das Aufschieben der Bettruhe. Der Begriff tauchte zum ersten Mal 2014 in einer Studie der niederländischen Psychologin Floor Kroese und ihren Kolleg:innen auf. Sie beschreiben damit die Beobachtung, dass viele Menschen später zu Bett gehen, als sie eigentlich wollen, ohne triftige externe Gründe dafür zu haben.
Die Rechnung dafür kriegt man direkt am nächsten Morgen. Nach zu wenigen Stunden Schlaf reisst einen der Wecker aus den Träumen und läutet hart den nächsten Tag ein. Im Zombie-Modus geht es aus dem Bett und man verflucht sich selbst warum man gestern nicht einfach rechtzeitig schlafen gegangen ist.

Wieso zögern wir das zu Bett gehen hinaus?
Die Zeit am Abend gehört uns. Während wir tagsüber viel «mussten», ist die Zeit am Abend für viele eine Art heilige Zeit. Die möchte man natürlich voll auskosten. Absurderweise tun wir in der Zeit, wo wir eigentlich bereits schlafen sollten, aber nicht Dinge, die uns guttun und aktiv zur Erholung beitragen. Anstatt uns an der frischen Luft zu bewegen, etwas Neues zu lernen oder eine Yoga-Einheit zu absolvieren, landen wir häufig vor dem Bildschirm. Daddeln am Handy oder sich vom Fernseher berieseln lassen, sind wenig anstrengende Tätigkeiten mit kurzfristigem Belohnungspotential und hohem Ablenkungsfaktor. Gerade wenn wir einen anstrengenden Tag hinter uns haben, ist die Selbstkontrolle besonders gering und die Gefahr das Zubettgehen aufzuschieben besonders hoch.
Ein weiterer Grund kann die eigene Abendroutine sein. Wer seine eigene Abendroutine nicht mag, scheint das Zubettgehen eher hinauszuzögern. Die Tasche für morgen packen, die Kleider fürs Büro rauslegen, den Hund nochmal an die frische Luft lassen, Zahnseide verwenden, die Kontaktlisten entfernen, alles Dinge, die nicht sonderlich viel Spass machen. In einer Studie (Bernecker & Job, 2020), in der über 430 Personen zwischen 19 und 79 Jahren befragt wurden, konnte gezeigt werden: Je nerviger die Befragten ihre Abendroutine fanden, desto eher neigten sie dazu sie aufzuschieben.

Wie kann man sich selbst überlisten?
Wer bemerkt, dass er zu Bedtime Procrastination neigt, sollte am besten zuerst sein Verhalten beobachten. Welche Funktion hat das Aufschieben? Ist es der Versuch Freizeit nachzuholen? Falls ja, kann es helfen mehr schöne Erlebnisse in den Alltag einzubauen oder den Tag anders zu strukturieren. Ist das Aufschieben ein Versuch sich von Sorgen oder Grübeln abzulenken, kann man versuchen die Problem oder Themen aktiv anzugehen – am besten tagsüber.
Studien konnten zeigen (z.B. Bernecker & Job, 2020; Kroese et al., 2016): Je erschöpfter wir sind, desto mehr steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der innere Schweinehund siegt und wir genau das tun, was wir vermeiden wollen. Daher müssen wir uns proaktiv selbst überlisten und Vorkehrungen treffen. Eine Möglichkeit ist übrigens auch die Abendroutine zu verschlanken. Klar, Elmex Gelee, Zahnseide und diverse Pflegeprodukte sind super aber, wenn wir dadurch das ganze Prozedere hinauszögern, ist eine «schnelle Version» nur mit den absolut notwendigen Schritten an schwierige Abenden besser.
Ausserdem kann es helfen die Prokrastinations-Quellen zu eliminieren, also zum Beispiel Regeln einzuführen wie 1h vor der geplanten Einschlafzeit Aktivitäten vor Bildschirmen zu vermeiden und auch das Handy nicht im Schlafzimmer zu haben.
Und noch ein Tipp für alle, deren Endgegner abends das Handy ist: Bei vielen Modellen kann man einstellen, dass sie ab einer gewissen Uhrzeit alles nur noch in schwarz-weiss anzeigen. Probiert das mal aus, da wird das Scrollen plötzlich sehr unattraktiv.
Literatur
Bernecker, K., & Job, V. (2020). Too exhausted to go to bed: Implicit theories about willpower and stress predict bedtime procrastination. British Journal of Psychology, 111(1), 126-147.
Kroese, F. M., De Ridder, D. T., Evers, C., & Adriaanse, M. A. (2014). Bedtime procrastination: introducing a new area of procrastination. Frontiers in psychology, 5, 611.
Kroese, F. M., Evers, C., Adriaanse, M. A., & de Ridder, D. T. (2016). Bedtime procrastination: A self-regulation perspective on sleep insufficiency in the general population. Journal of health psychology, 21(5), 853-862.