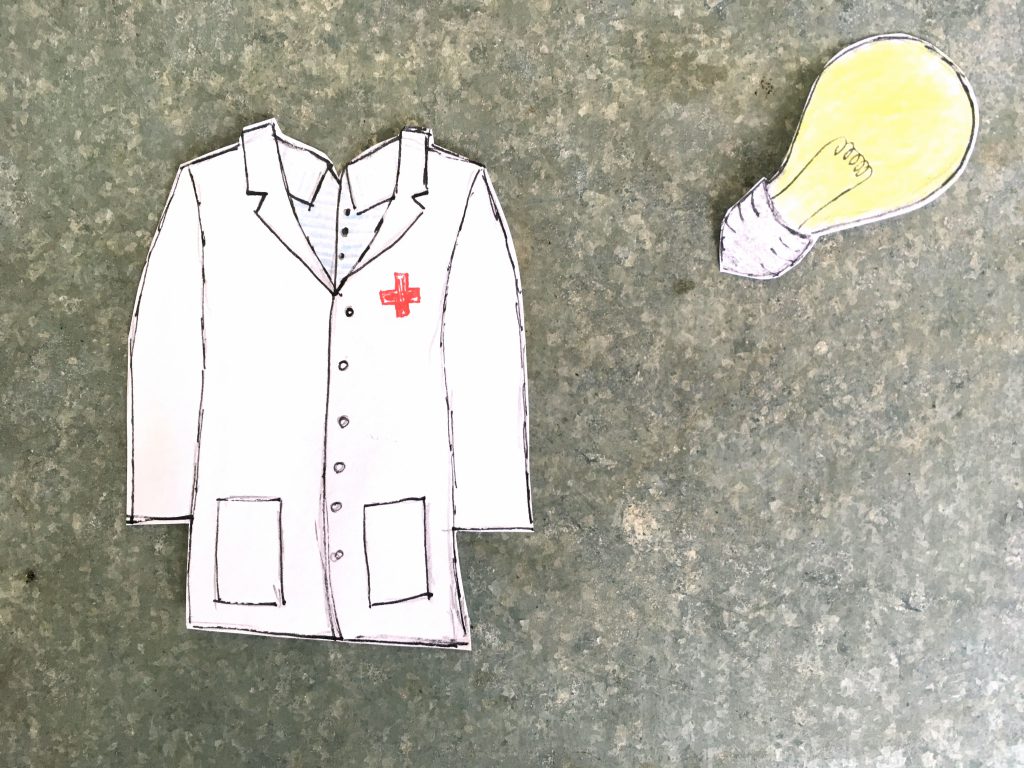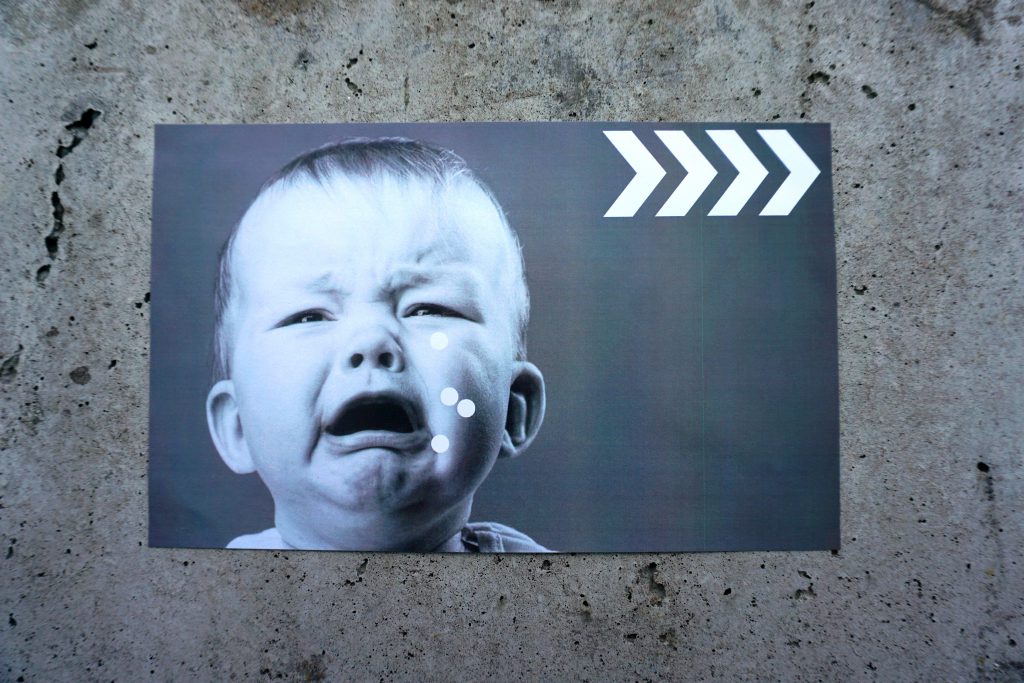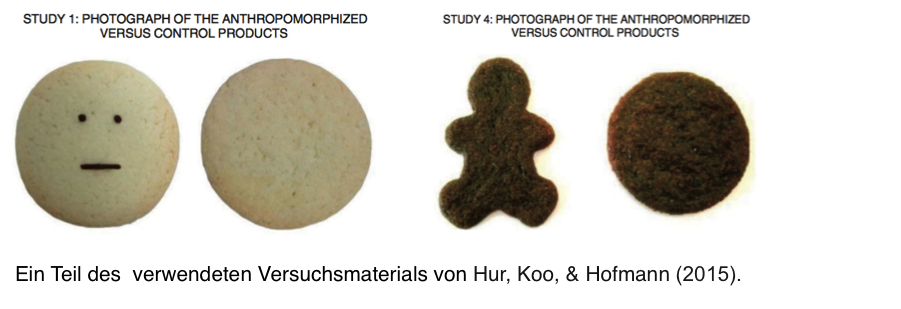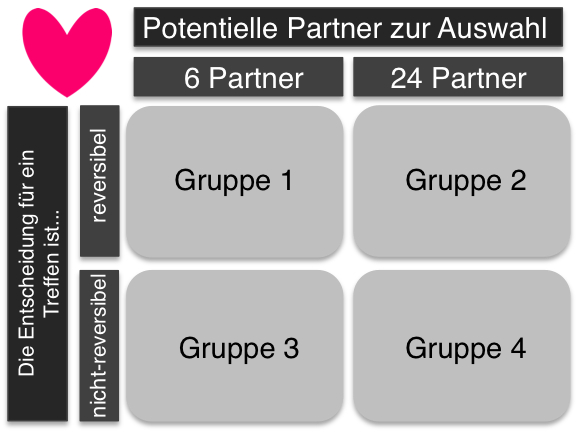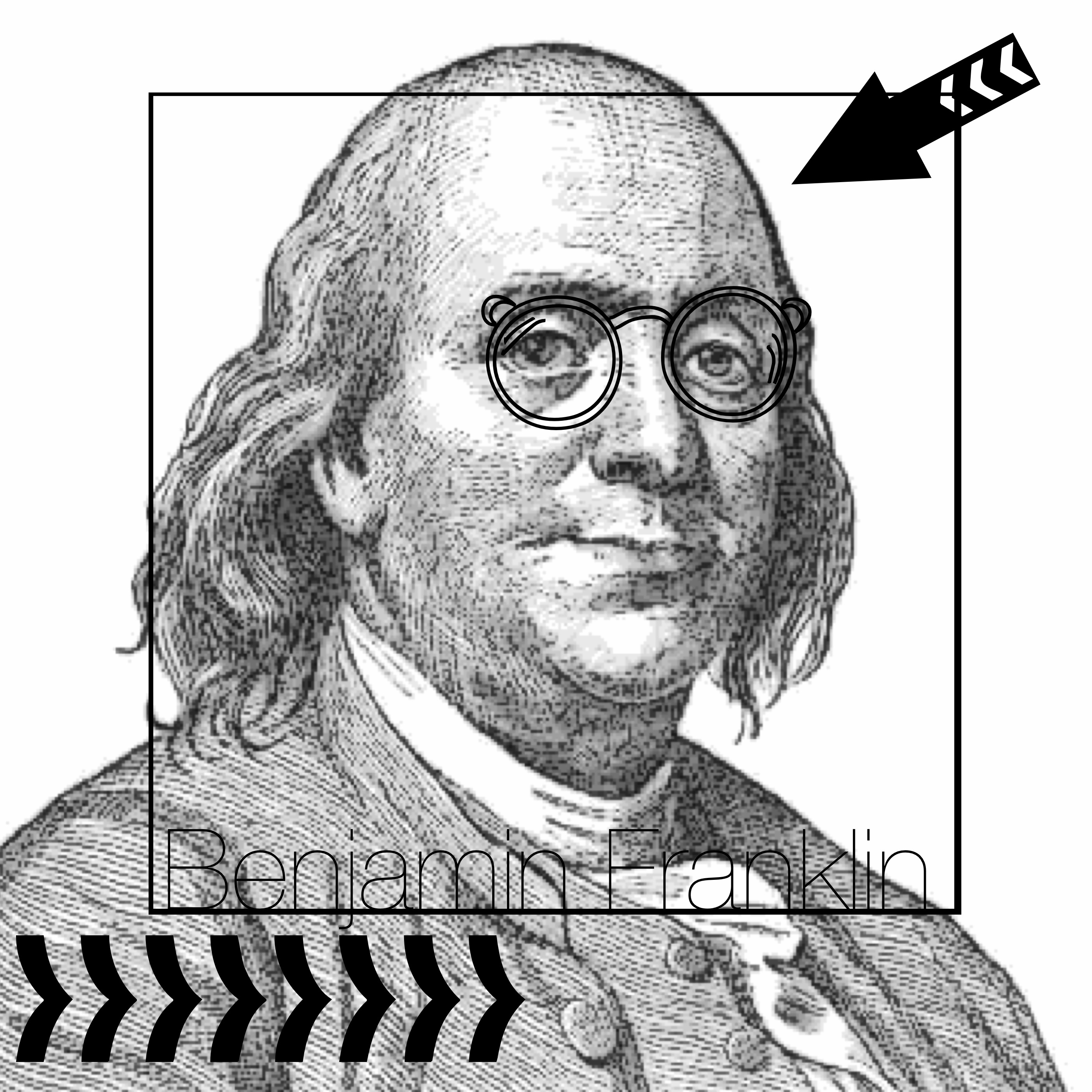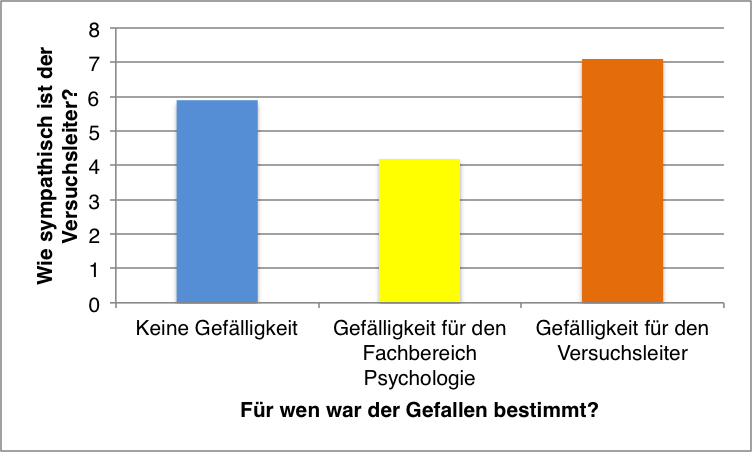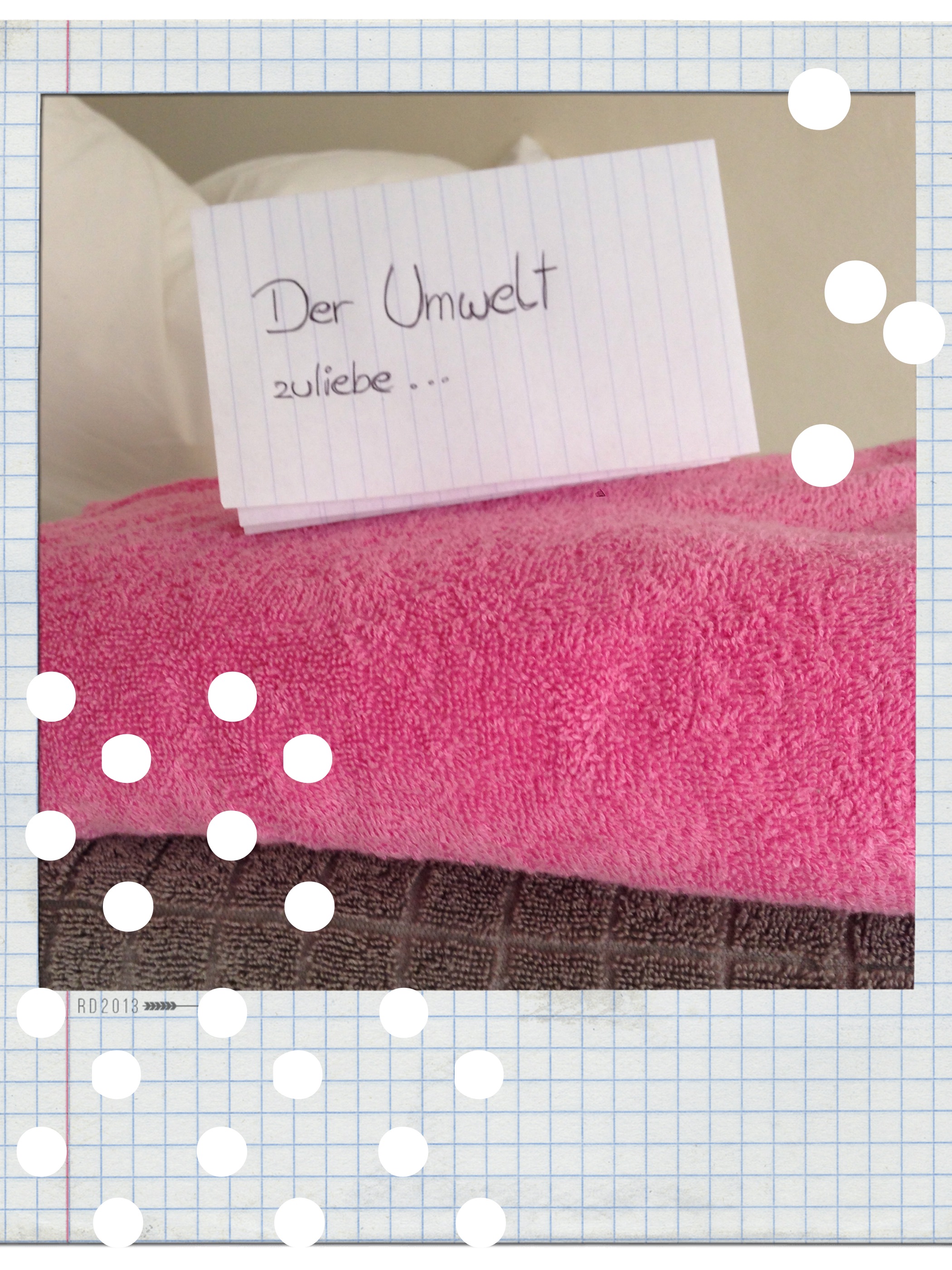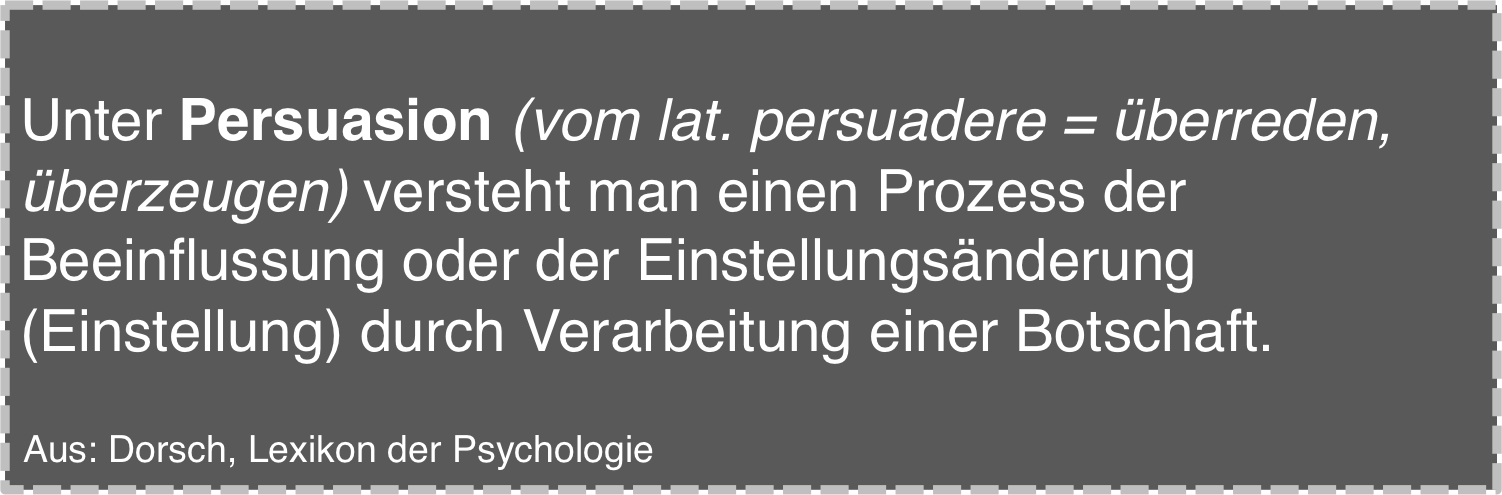Es gibt Schleicher, es gibt Spazierer und es gibt mich. Ich bin ein Speed-Geher oder ein Marschierer. Jeder Tag sollte meiner Meinung nach sowieso mindestens 28h Stunden haben, damit ich annähernd für all die Dinge Zeit habe, die ich gerne machen würde. Daher gilt es die Wachzeit zu optimieren. Das geht ziemlich gut, wenn man versucht Wege von A nach B zu beschleunigen. Ein Grund, warum ich gerne mit dem Fahrrad fahre anstatt zu laufen. Geht einfach schneller (bitte entschuldigt den Wortwitz, aber den konnte ich mir nicht verkneifen).
Laufen Wahnsinnige schneller?
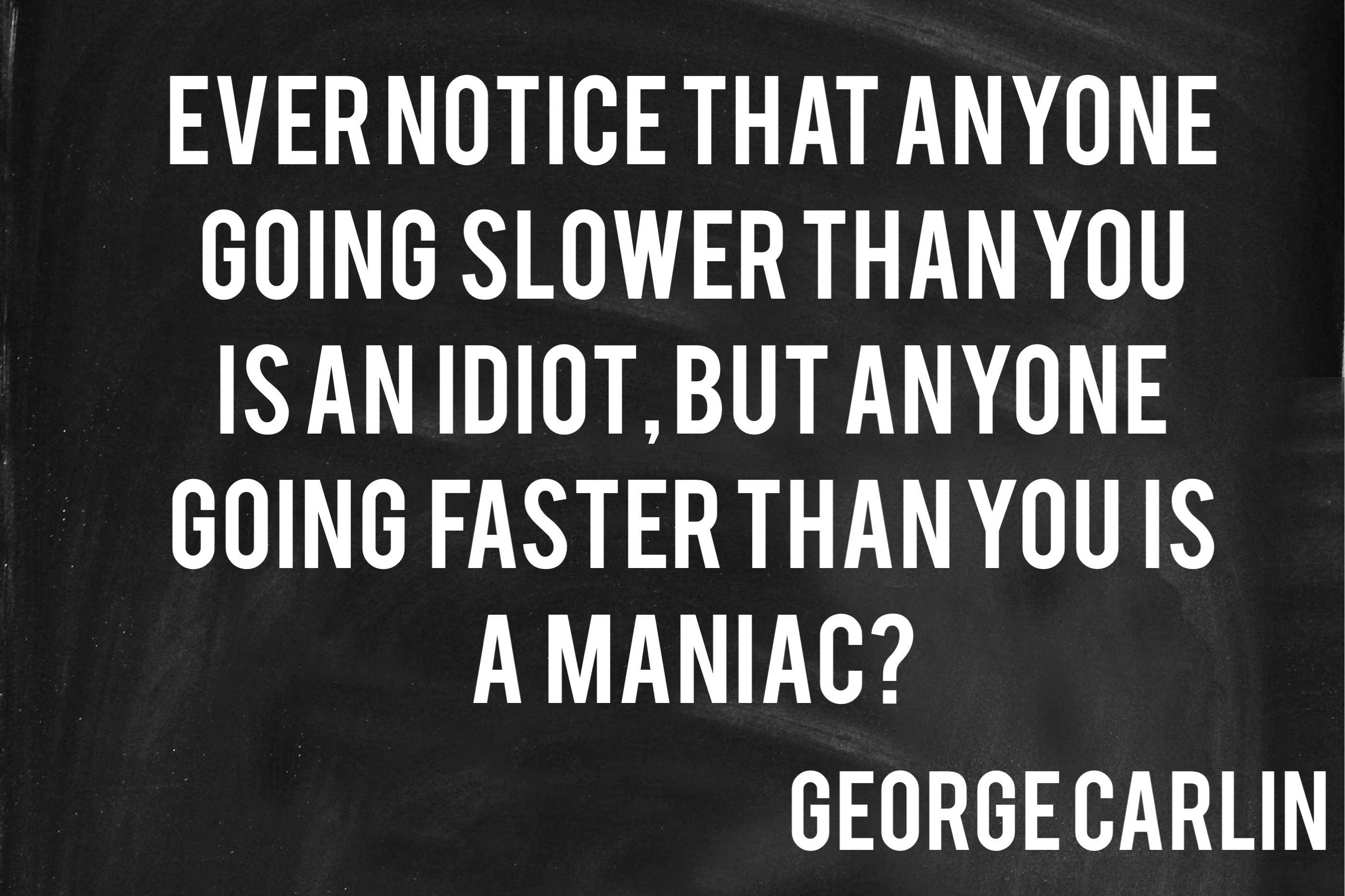
Wenn der US-Comedian George Carlin recht hat, dann gehöre ich wohl eindeutig in die Kategorie „Maniac“, bin also laut Herrn Carlin eine Wahnsinnige. Was an Behauptung dran ist, hat der amerikanische Marketingprofessor Carey Morewedge mit seinen Kollegen wissenschaftlich untersucht. Die Wissenschaftler interessierte welchen Einfluss die Bewegungsgeschwindigkeit auf die Zuschreibung bestimmter mentaler Fähigkeiten hat. Dafür untersuchte er nicht nur Menschen, sondern auch Tiere und Roboter.
Die Forscher zeigten den Versuchsteilnehmern in zufälliger Reihenfolge je drei Filme von Menschen, die sich entweder langsam, mittel schnell oder schnell bewegten. Im Anschluss dran sollten die Probanden bewerten wie kompetent, intelligent und clever die jeweiligen Personen seihen. Dabei zeigte sich, dass Personen die mit moderatem Tempo gingen die besten Bewertungen erhielten. Sie wurden als kompetenter, intelligenter und cleverer wahrgenommen.

Wer langsamer geht, wird positiver eingeschätzt.
Menschenähnliche Geschwindigkeiten werden bevorzugt
In zwei weiteren Studien ließen die Forscher die Bewegungsgeschwindigkeit von Robotern und Tieren bewerten. In beiden Studien wurden den Robotern und Tieren, die mit mittlerer Geschwindigkeit unterwegs waren, mehr positive menschenähnliche Eigenschaften zugeschrieben. Am besten fielen die Bewertungen aus, wenn sie der Fortbewegungsgeschwindigkeit des Menschen ähnelten. Eine Erkenntnis, die gerade für die Konstruktion der Programmierung von Robotern, die uns im Alltag helfen sollen, äußerst relevant ist. Die Forscher erklären sich dieses Ergebnis damit, dass es Menschen leichter fällt Dinge einzuschätzen, die uns ähneln und irgendwie menschlich sind. Im Umgang mit Menschen sind wir schließlich geübt.
Wichtig ist allerdings, dass es sich immer um die relative Geschwindigkeit handelt. Ist man mit älteren Kollegen unterwegs, ist es nicht nur aus Gründen der Höflichkeit empfehlenswert, sich deren Tempo anzupassen. Vielleicht halten die Kollegen einen dann auch für intelligenter und wie bereits Konfuzius wusste „Der Weg ist das Ziel“. Vielleicht sollte auch ich mir das zu Herzen nehmen.
Literatur
Morewedge, C. K., Preston, J., & Wegner, D. M. (2007). Timescale bias in the attribution of mind. Journal of personality and social psychology, 93, 1-11.